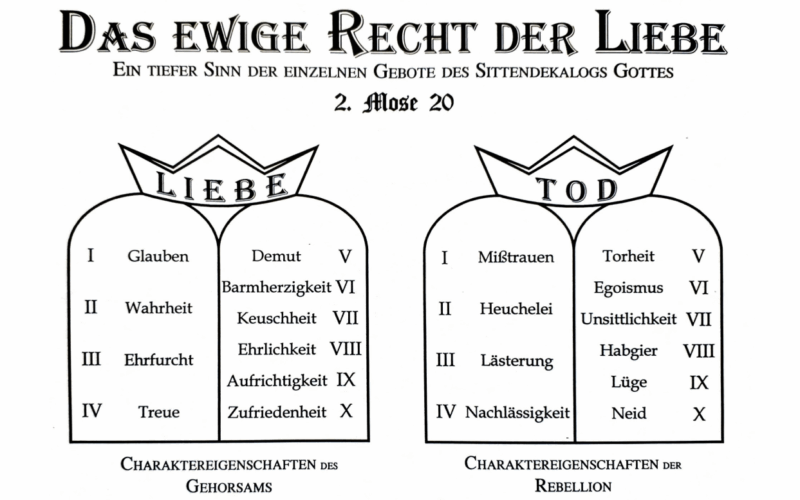Im zweiten Gebot geht es um Wahrheit
Wahrheit« spielt eine entscheidende Rolle bei der Anbetung Gottes. Deshalb verwenden wir »Wahrheit« als Schlüsselbegriff für das zweite Gebot.
»Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich.« (Psalm 119,160 Luther) Beim zweiten Gebot geht es um den wahren Gott und richtige Anbetung.
Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Sie liegt jedoch oft nur haarscharf neben der Wahrheit. Dann verschmelzen Wahrheit und Lüge so gut, dass es schwer sein kann, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden.
Das erste Gebot warnt vor anderen Göttern. »Du wirst keine anderen Götter haben neben mir!« Die Bibel weist vor allem auf einen ganz bestimmten anderen Gott hin: »Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist‘s denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der GOTT DIESER WELT den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums.« (2 Korinther 4,4) Dieser falsche Gott wollte von Jesus angebetet werden: »Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: Du wirst den Herrn, deinen Gott, anbeten und Ihm al-lein dienen!« (Matthäus 4,10) Jesus nennt den Gott dieser Welt »Satan«.
Satan hat sich eine eigene Religion ausgedacht. Durch sie möchte er verehrt werden. Sie besteht aus einem ganzen Pantheon von Göttern. An ihrer Spitze steht meist der Sonnengott. Er trägt in den verschiedenen Kul- turen unterschiedliche Namen: In Ägypten Aton oder Re, in Indien und Persien Mithras und in Rom Sol Invictus. Im Palästina biblischer Zeit trat der Gott Baal in Konkurrenz zum Gott Abrahams. Da diese Religion ein Gegenstück zur wahren Anbetung ist, hat Satan sich und seine Religion gut getarnt. So kann er auch Anhänger des wahren Gottes verführen.
Das zweite Gebot konkretisiert und vertieft das Verständnis des ersten Gebotes. Es zeigt, wie der Gott dieser Welt uns unmerklich und schrittweise vom wahren Gott wegführen kann. Es lautet: »Du wirst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du wirst dich vor ihnen nicht niederwerfen (um deine Ehrfurcht zu bezeugen) und ihnen nicht dienen.« (2. Mose 20,4.5 Elberfelder)
Was bedeuten diese Worte? Wie wurden sie zu der Zeit verstanden, als sie geschrieben wurden? Damals gab es keine Bilder, also Gemälde oder Statuen zu Dekorationszwecken in Wohnungen. Bilder wurden anfangs nur für kultische Zwecke hergestellt. Diese Information lässt uns das zweite Gebot besser verstehen: »Du wirst dir kein Götterbild für kultische Zwecke machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.«
Noch heute verwenden viele Menschen auf der Welt an ihren Anbetungsstätten Bilder und Statuen. Auf das zweite Gebot angesprochen, erklären sie oft: Wir beten diese Bilder nicht an, sondern benutzen sie lediglich als Meditationshilfe zur Anbetung des wahren Gottes. Untersuchen wir aber das zweite Gebot genau, dann entdecken wir, dass es aus vier Paragraphen besteht:
Erstens:
»Du wirst dir kein Götterbild machen.« Allein die Herstellung eines Bil- des für kultische Zwecke ist also schon eine Missachtung des zweiten Gebots.
Zweitens:
»auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.« Diese Erweiterung ver- tieft das Gebot. Ein anderer Vers erklärt auch: »Verflucht sei, wer ein ge- schnitztes oder gegossenes Bild macht, das dem Herrn ein Greuel ist, und es heimlich aufstellt!« (5. Mose 27,15) Wer also ein Kultbild aufstellt, miss- achtet das zweite Gebot.
Drittens:
»Du wirst dich vor ihnen nicht niederwerfen (um deine Ehrfurcht zu bezeugen).« Wer beim Beten ein Bild als Meditationshilfe benutzt, übertritt das zweite Gebot.
Viertens:
»und ihnen nicht dienen!« Wer um ein solches Bild überhaupt in irgend- einer Form einen Kult macht, handelt auch dem zweiten Gebot zuwider. Schon kleine Kultgegenstände führen allmählich zur Verehrung und schließlich zur Anbetung.
Das bekannteste Beispiel für Götzendienst finden wir in 2. Mose 32,1-6. Gott hatte Mose auf den Berg Horeb gerufen, während das Volk Israel um den Berg herum lagerte. Als Mose zu lange wegblieb, verlangte das Volk ein sichtbares Kultobjekt, das sie auf ihrer Wanderung weiterführen soll- te. Sie machten sich ein goldenes Kalb nach dem Vorbild des ägyptischen Stiergottes Apis, der die Sonnenscheibe des Sonnengottes Re zwischen den Hörnern trägt. Als es fertig war, jubelten sie. »Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.« (2. Mose 32,4 Luther) Sie meinten mit diesem Symbol die Kraft ihres Gottes darzustellen. Dann bauten sie noch einen Altar und feierten mit Opfern die Einweihung des neuen Füh- rers, angeblich als Fest für den Herrn, und hier wird das Tetragrammaton genannt, der hebräische Name des Gottes Abrahams und Israels. Sie waren so verblendet, dass sie der Meinung waren, dadurch dem wahren Gott zu dienen. Tatsächlich jedoch huldigten sie einem fremden Gott und trie- ben damit den im zweiten Gebot streng verbotenen GötzendienstDas Fest war ein rauschender Feiergottesdienst für alle Sinne.
Das zweite Gebot macht darauf aufmerksam, dass jede Übertretung klein beginnt. Wehret den Anfängen! Schon ihr Keim, ihre Wurzel ist Gift für unsere Beziehung zu dem wahren Gott. Das zweite Gebot warnt vor allen Kultbildern. Denn sie lassen eine falsche Religion mit einem falschen Gott entstehen und verdrängen schließlich die Anbetung des wahren Gottes, selbstwenn die Namen der Symbole und Feste sich scheinbar noch auf den Gott der Bibel beziehen. Das unter Christen am weitesten verbreitete Kultbild ist das Kreuz. In christlichen Ländern begegnet man ihm fast überall. Ursprünglich war es ein Kultgegenstand im Sonnenkult, ein Sonnenzeichen. Es wurde auch als Altar benutzt, auf dem Menschen dem Sonnengott geopfert wurden Erst im 4. Jh. n. Chr. führte man das Kreuz als Symbol für die Erlösung durch Jesus Christus ein. Dabei berief man sich auf den Kreuzestod Jesu auf Golgatha. Dies geschah in einer Zeit, in der immer mehr Elemente aus heidnischen Götterkulten christianisiert wurden. Das Kreuz als Kultobjekt ist heute zum Beispiel als Amulett bis weit über christliche Kreise hinaus in Gebrauch. Das Kreuzzeichen, also das Sich-Bekreuzigen ist ein Beispiel dafür, wie aus einem solchen Kultobjekt ein Ritual entstehen kann, das ebenso dem Geist des zweiten Gebotes fremd ist.
Viele Menschen glauben, dass die Seelen Verstorbener in der Gegenwart Gottes als Fürsprecher für die Menschen leben und beten deshalb vor Heiligenbildern an. Auch das stammt aus Religionen, in denen viele Göt- ter verehrt werden, Götter, die angeblich Einfluss auf das Schicksal der Menschen haben.
Außer durch Verehrung von Bildern, Symbolen und Skulpturen aus Gold, Silber, Holz und Stein werden fremde Götter auch durch Feiertage ver- ehrt. Die alljährliche Neugeburt des Sonnengottes wurde in den so genannten Heiligen Nächten mit großem Prunk gefeiert. Diese Feier wurde von der Christenheit übernommen. Man beruft sich dabei auf die GeburtJesu zu Bethlehem, die wohl kaum zu dieser Jahreszeit stattgefunden hat. Das ist der Hintergrund zur Entstehung der Weihnachtsfeiertage.
Auch die Osterbräuche spiegeln den Einfluss heidnischer Kulte wider. Die Babylonier verehrten zu dieser Jahreszeit die Göttin der Fruchtbarkeit Astarte (Ostara). Sie glaubten, dass sie aus einem wundersamen Riesenei ausgebrütet wurde. Deshalb bemalte man die Eier mit bunten Farben und brachte sie der Göttin als heilige Gaben. Der Osterhase, auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, durfte die Eier tragen.
Alle diese Abbilder, Symbole und Feiertage sind eine Missachtung des zweiten Gebots. Sie verleiten dazu, andere Götter neben den wahren Gott zu stellen und somit auch das erste Gebot zu übertreten. Gott warnt in seinem Gebot auch vor den Folgen: »Du wirst dich vor ihnen nicht nie- derwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen.« (2. Mose 20,5.6)
Gott kann die verheerenden Folgen nicht verhindern. Wer an Gottes Ver- fassung und damit an dem Lebensspender und – erhalter vorbeigeht, muss ernten, was er sät. Der Gott dieser Welt wird in der Bibel auch Dia- bolos genannt. Das heißt wörtlich Durcheinanderbringer und wird meist mit Teufel übersetzt. Wer ihn verehrt, erntet satanische Früchte: Unfriede, Hass, Streit, Ungerechtigkeit, Krieg und Zerstörung. Trotzdem bietet Gott den irregeleiteten Menschen aus Liebe und Gnade Rettung an, ein neues Leben nach seinen Gesetzen. Paulus beschreibt diesen liebevollen Gott, wenn er sagt: »… welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.« (1. Timotheus 2,4) Das Gebot endet deshalb mit einer wunderbaren Verheißung »… der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote hal- ten.« (2. Mose 20,5.6)
Gott begnadigt alle, die ihn suchen und lieben. Wer sich ihm hingibt, wer sich von ihm regieren lässt, wer seine guten Gebote befolgt, wird mit Segen, Frieden und Freude beschenkt. Ein Leben in Freiheit und Gerechtig- keit ist nur denen garantiert, die den wahren Gott des Universums anbe- ten. Nur sein Geist kann den Menschen mit wahrem Leben erfüllen. Dieser Geist kann aber nur dort uneingeschränkt zum wirken kommen, wo keine falsche Anbetung ihn daran hindert. Jesus selbst sagt, was richtige Anbetung ist: »Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.« (Johannes 4,24) Beten wir mit dem Psalmisten: »Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott mei- nes Heils; auf dich harre ich allezeit.« (Psalm 25,5)
Wer die Wahrheit und damit den ewigen Gott liebt, wird keine Kultbilder und – symbole verehren und keine Feste feiern, die ihren Ursprung in einer anderen Religion haben. Für ihn ist das Gebot eine Verheißung. Denn man kann es aus dem Hebräischen auch so übersetzen: »Du wirst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild!«